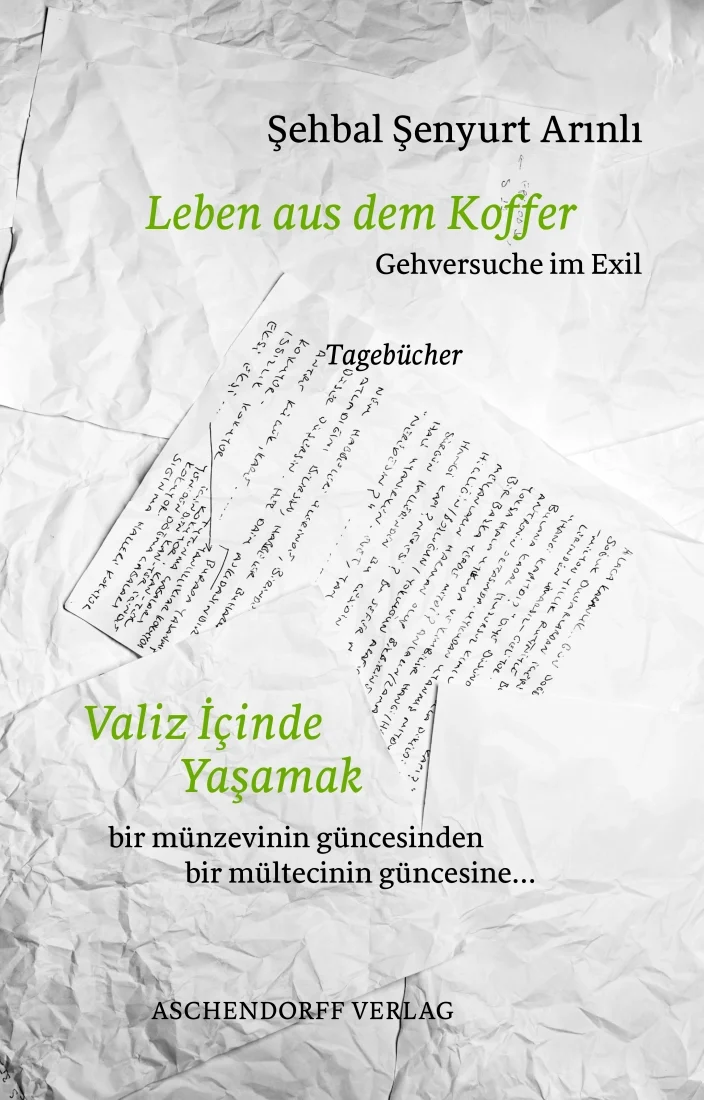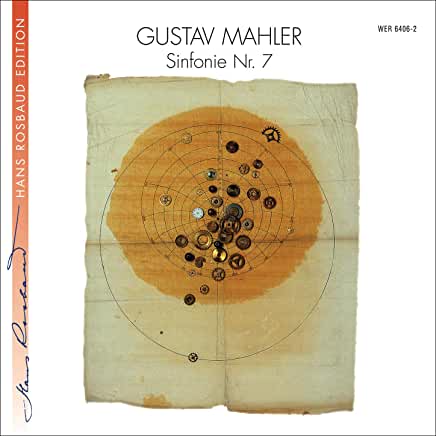Ostern mit Jacques Lacan und der Villa Massimo
Montag, 5. April 2021, bei „Vagabond“ von Ulf Wakenius
Ostern kommt etwas schäbig daher. Schon gestern war es kalt und windig, heute regnet es mir bei 6 Grad die Scheiben voll, sodass ich die seit über einer Woche blühenden Blumen nur noch als bunte Farbtupfer vor dem Arbeitszimmerfenster zu erkennen vermag.
Ja, ich arbeite selbstverständlich auch über Ostern. Im Grunde sind für mich jetzt zu Ostern nur zwei Dinge verändert. Erstens habe ich ein zweites Ei gegessen, sonst beschränke ich mich auf eines pro Woche, jeweils zum Frühstück am Sonntag. Und zweitens essen wir nachmittags zum Tee von dem Osterbrot, dass uns unsere Freundin Andrea geschickt hat; sie ist auch eine begeisterte Leserin und steht deshalb meinem kleinen Erzgebirgischen Fan-Club vor. Danke für beides.
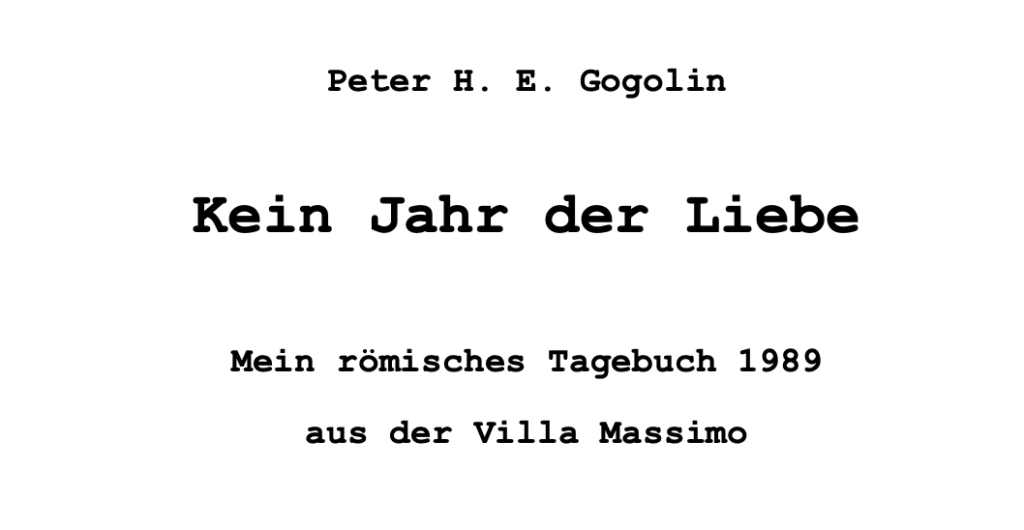
Wie in den letzten Wochen besteht meine Arbeit darin, letzte Hand an das Manuskript meines römischen Tagebuches zu legen. Ursprünglich hätte es schon 2019 erscheinen sollen. Das hat mein Schlaganfall verhindert. Aber ich bin ja hartnäckig, und so nutze ich nun das zweite Pandemie-Jahr, um auch diese Arbeit zu einem Ende zu bringen, so wie ich zuvor bereits meinen Band mit phantastischen Erzählungen „Isoldes Liebhaber“ im August 2020 und den Roman „Nichts weißt du, mein Bruder, von der Nacht“ zu Februarbeginn diesen Jahres veröffentlicht habe.
Im Vorwort des Tagebuches heißt es:
(c) aus Peter H. E. Gogolin: Kein Jahr der Liebe
Vieles auf den folgenden Seiten wird heutigen Lesern allerdings merkwürdig anachronistisch erscheinen. Das liegt daran, dass es Nachrichten aus einer Welt sind, die sich mittlerweile so oft „weitergedreht“ hat, dass sie sich kaum noch jemand vorzustellen vermag. Ich spreche von einer Welt ohne Handys, ohne Navi, überhaupt ohne Internet, also auch ohne eMail. Wir schrieben Briefe, die im Postverkehr zwischen Italien und Deutschland oft bis zu fünf, sechs Wochen unterwegs waren, wenn sie nicht überhaupt verlorengingen. Ich spreche auch von einer Zeit ohne gemeinsamer Europäischer Währung und leicht zugänglichen Geldautomaten und Kreditkarten. Wenn ich Geld für unser italienisches Leben von meinem Hamburger Konto benötigte, standen mir mühsame Bankoperationen mit zu genehmigenden Euro-Schecks bevor, die misstrauisch beäugt wurden und sehr hohe Gebühren kosteten. Wir versuchten den Nachrichtenverkehr nach Deutschland möglichst telefonisch abzuwickeln. Aber das bedeutete unter Umständen für ein einziges Gespräch ein Dutzend und mehr Versuche über ein Festnetztelefon, bei denen die Verbindungen immer wieder abrissen oder nur der Gesprächspartner auf der einen Seite zu verstehen war, während der andere so laut schreien konnte, wie er wollte, er schrie ins Nichts. Von den Kosten solcher Telefonate schweigt man aus Scham. Wir hatten nicht mal einen Fernseher. Hätte es in der Villa Massimo Fernsehanschluss gegeben, so wären wir jedoch eh auf italienische Telenovelas beschränkt gewesen, denn auch der Satellitenempfang war noch nicht erfunden, sodass uns keine ausländischen Sender zur Verfügung gestanden hätten. Dass es so etwas dereinst geben würde, wäre Science Fiction gewesen. Den Kontakt zum Weltgeschehen versuchte ich deshalb mittels eines zigarettenschachtelgroßen Kurzwellenradios aufrecht zu erhalten, auf dem ich die verrauschten Nachrichten der Deutschen Welle einfing. Ich spreche auch von einer Zeit, in der das Krankwerden eine massive Bedrohung war, denn es gab keine internationalen Vereinbarungen zwischen den Gesundheitskassen. Und um an Tankstellen zu tanken, kaufte man vorher Tankgutscheine, möglichst schon an der Grenze. Wer sich bei der Lektüre ganz allgemein irritiert fühlt, der bedenke, dass es auch noch niemanden gab, der sich eine Rechtschreibreform hatte einfallen lassen. Ich schrieb also 1989 alte Rechtschreibung und habe das für diese Publikation auch nicht nachträglich geändert. Ach, nicht einmal die Postleitzahlen waren gleich. Willkommen also in der guten alten Zeit.
Da ich wie immer zuversichtlich bin, so gehe ich davon aus, dass ich das Manuskript noch in diesem Monat fertigstellen und an den Verlag geben kann. Jetzt muss an sich nur noch mein umfangreiches Interview mit der Schriftstellerin Luise Rinser hinein, für das ich zusätzlich eine kurze Einführung schreiben muss, und mein Artikel über den Jesuiten und Zen-Priester Hugo Enomiya-Lassalle. Der Satz des Manuskriptes wird dann noch etwas Zeit verschlingen, denn es ist auch recht lang. Aber bis zum Herbst sollte alles klappen.
Ach, der im Titel angekündigte Jacques Lacan fehlt noch. Ich hätte nie gedacht, dass ich so sehr Lacan-Schüler bin, dass er mich im Traum aufsucht. Aber andererseits kommen so viele Tote im Traum zu mir, warum also nicht auch Lacan?

Auf jeden Fall saß ich in einer seiner Vorlesungen. Als er ausführte, dass auch das Unbewusste der Struktur des Symbolischen unterliegt, fiel sein berühmter Satz „Das Unbewusste ist wie eine Sprache strukturiert.“ Ich befand mich also offensichtlich in seinem ‚Seminar XI‘ über die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse.
Da hob ich den Arm, unterbrach ihn und fragte, ob man sich, wenn man postuliere, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert sei, nicht mehr Probleme einhandele, als man damit vermeintlich löse. Fragend sah er mich an. Nun, sagte ich, immerhin sei jede Sprache arbiträr, gelte das dann auch für die Struktur des Unbewussten? Und falls ja, wohin führe uns die Idee eines willkürlichen Unbewussten?
Noch weiter und anders gefragt, welche Grammatik liege der sprachlichen Struktur des Unbewussten zu Grunde? Da es ja, Noam Chomsky zum Trotz, keine universelle Grammatik gibt, sagte ich, schon gar keine angeborene, sondern nur sehr verschiedene, welche habe das Unbewusste dann?
Es gebe, um nur einige Beispiele zu nennen, solche mit vier Fällen ebenso wie solche mit fünf. Es gebe solche, die das grammatische Geschlecht klar differenzieren, und solche, die das gar nicht tun – schon im Englischen ist das der Fall, sagte ich. Und etwa im Niederdeutschen wird aus der, die, das einfach ein ‚de‘ – also ‚de Mann‘ und ‚de Frau‘.
Vom Wortschatz wolle ich ganz schweigen, obwohl es mir schon wesentlich schiene, ob man eine Sprache spreche, die 50 Wörter für Schnee besitzt, statt des einsamen ‚la neige‘ des Französischen. Aber was wird überhaupt aus der Psychoanalyse, fragte ich, wenn das Unbewusste keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern macht? Wenn die Sprache, nach der es strukturiert sei, diesen Unterschied nicht mache, dann …
An dieser Stelle meines Traumes stellte ich fest, dass Jacques Lacan verschwunden war. Der Meister war einfach weg. Die übrigen Anwesenden starrten mich schweigend an. Ich erwachte.
Joyeuses Pâques
wünscht PHG