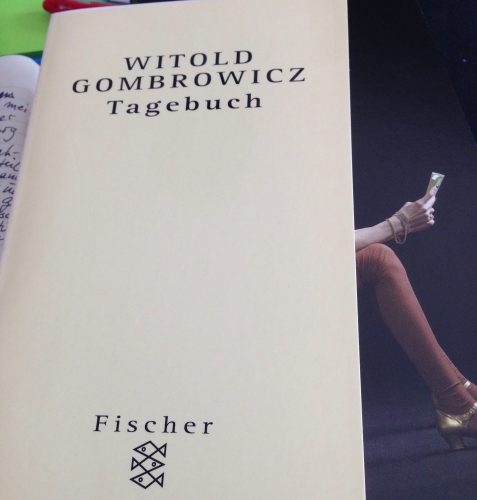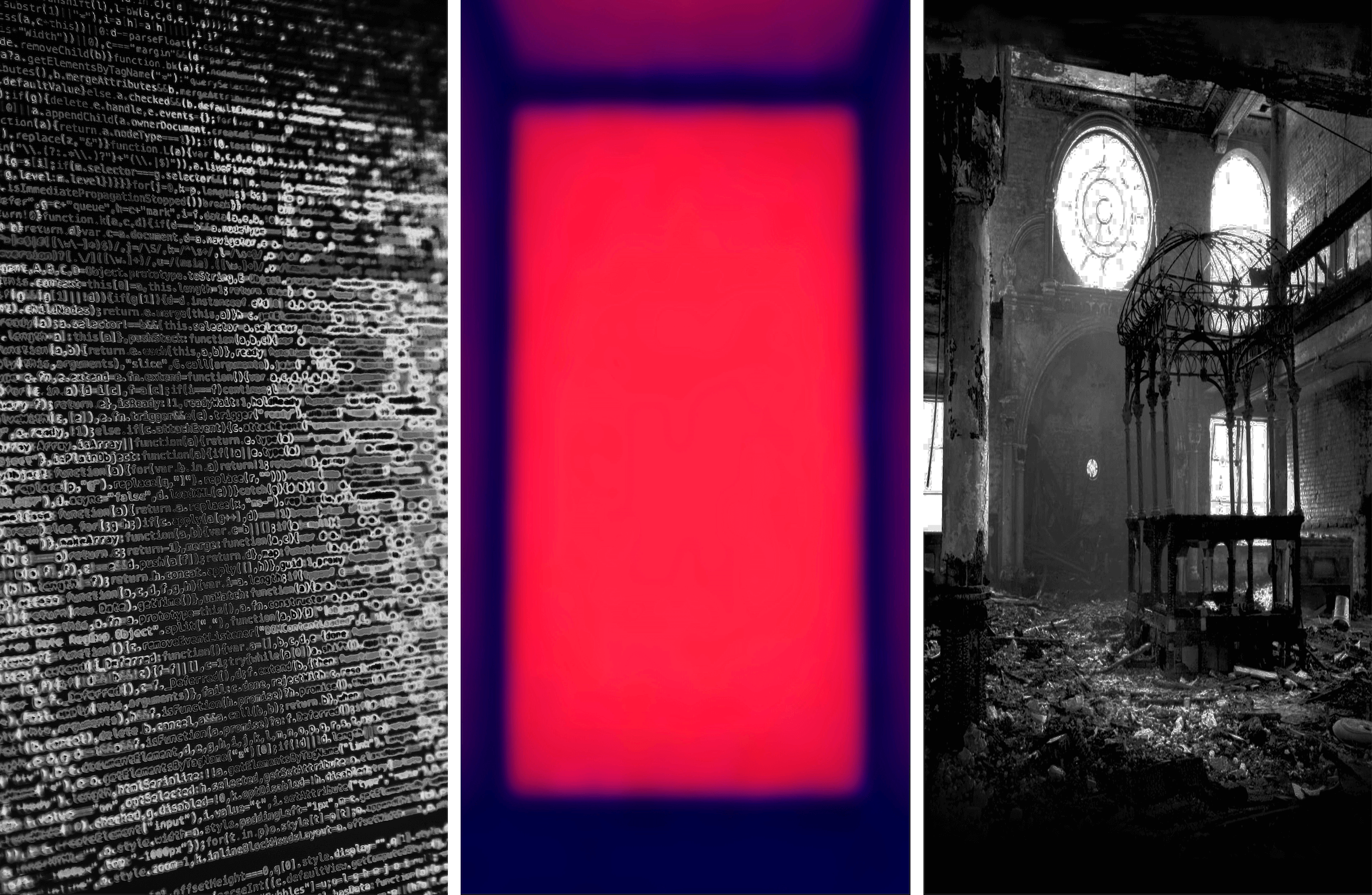Dieses Jahr
DIES JAHR
Dies Jahr
trennen die Schneider
alle Nähte auf
die Zahnärzte schreiben Gedichte
Löwen kommen
aus dem Süden
und suchen Einlass.
Dies Jahr
fragt dich ein Kobold
nachts im Wald
wer du denn bist
da weißt du’s nicht.
(Jutta Schubert)
Donnerstag, 3. Mai 2018, [Dylan: Tell Tale Signs]
Es ist kalt geworden, trotzdem las ich am Morgen einige Zeit bei offenstehender Balkontür in Gombros Tagebüchern, die ich vor einer Woche begonnen habe.
Sobald er sich konkreten Ereignissen zuwendet, wird er interessant. Doch er befasst sich eindeutig zu sehr mit der polnischen Literatur, dem Verhalten von Schriftstellern, die er gekannt hat, als er noch in Polen lebte, und die er jetzt kritisieren zu müssen meint, mit der Lage der Nation insgesamt und der polnischen Intelligenz überhaupt.
Sicher, das lag ihm als gewissermaßen zwangsweise Exiliertem sehr am Herzen, war vermutlich sogar die einzige Art und Weise für ihn, wenigstens im Tagebuch Kontakt zu halten. Heute wirkt das aber ungemein geschwätzig und zeigt die ganze Problematik solch intellektueller Kopfgeburten.
Sagte nach dem Frühstück zu J., dass ich gegenwärtig gar nicht wisse, wer ich sei. Dass ich es aber auch gar nicht wissen wolle. Sie erinnerte sich darauf sofort an ihr Gedicht ‚Dies Jahr‘, das ich sie für mich zu notieren bat. Ich hatte eigentlich nur ausdrücken wollen bzw. hauptsächlich ausdrücken wollen, dass ich nach den vielen Arbeiten seit Jahresbeginn, nun in einer Art Ruhephase angekommen sei, in der mich kein Text mehr bedrängt. Später begriff ich, dass sie meinen Satz in viel umfassenderem Sinn verstanden hatte – und damit auch absolut richtig verstanden hatte -, denn mir fiel Handkes Bemerkung aus dem Interview mit Gamper ein, wo er sagt, dass das ‚Schreiben ja immer für einen Schriftsteller mit dem Leben eigentlich identisch ist‘. Das ist der Punkt; man möge die Schlussfolgerung daraus ziehen.
Aber was will man eigentlich, wenn man schreibt? Ich denke, es liegt in letzter Instanz immer der Versuch zu Grunde, etwas Geformtes zu machen, eine geordnete Form zu produzieren, inmitten der großen Unordnung der Welt. So wie der kleine Johannes, der Ich-Erzähler in meinem Roman „Stahlwerkstraße“, den ich gerade entwerfe, seine Sehnsucht nach dem Geformten auszudrücken versucht, wenn er von der seidig glatten Oberfläche der Schneiderkreide spricht, die ihm wie ein Sinnbild des Perfekten erschienen sei. Und er betrachtet das als den krassen Gegensatz zur Realität der Stadt, in der er in der frühen Nachkriegszeit lebt. Es gab ja gar nichts perfekt Geformtes um uns herum, sagt er, denn wir lebten immer noch inmitten der Trümmer, die der Krieg zurückgelassen hatte.
Freilich liegt hier ein Problem vor, das sich dem Schriftsteller im Grunde erst seit dem Tod Gottes in voller Dringlichkeit stellt. Also seit wann? Seit dem Auftreten Nietzsches? Oder doch vermutlich schon seit 1755, dem Erdbeben von Lissabon? Gleichviel, in einer von Gott getragenen Welt ist alles von Gott gemacht und gewollt, und was Gott getan ist wohlgetan. Dort stellt sich das Problem nicht, und alles, was der Künstler tun kann, ist ein Nachschaffen, man schreibt Gott, dem großen Autor des Universums, lediglich hinterher. Begreift man aber einmal die Leerstelle, die dort regiert, wo wir vor dem diesen großen Autor vermutet haben, dann stehen wir in unserer Kleinheit vor dem ungeheuren Chaos und müssen versuchen, wenigstens in dem gerade in Arbeit befindlichen Werk zwischen zwei Buchdeckeln, einen geordneten Kosmos zu schaffen, eine Form in das Chaos zu bringen, Satz für Satz.
Und nachts im Wald, im Wald der Welt, kommt dann der Kobold, die Schwundform des alten Gottes, und fragt dich, wer du bist, dass du das zu tun wagst. Und da weißt du es nicht.