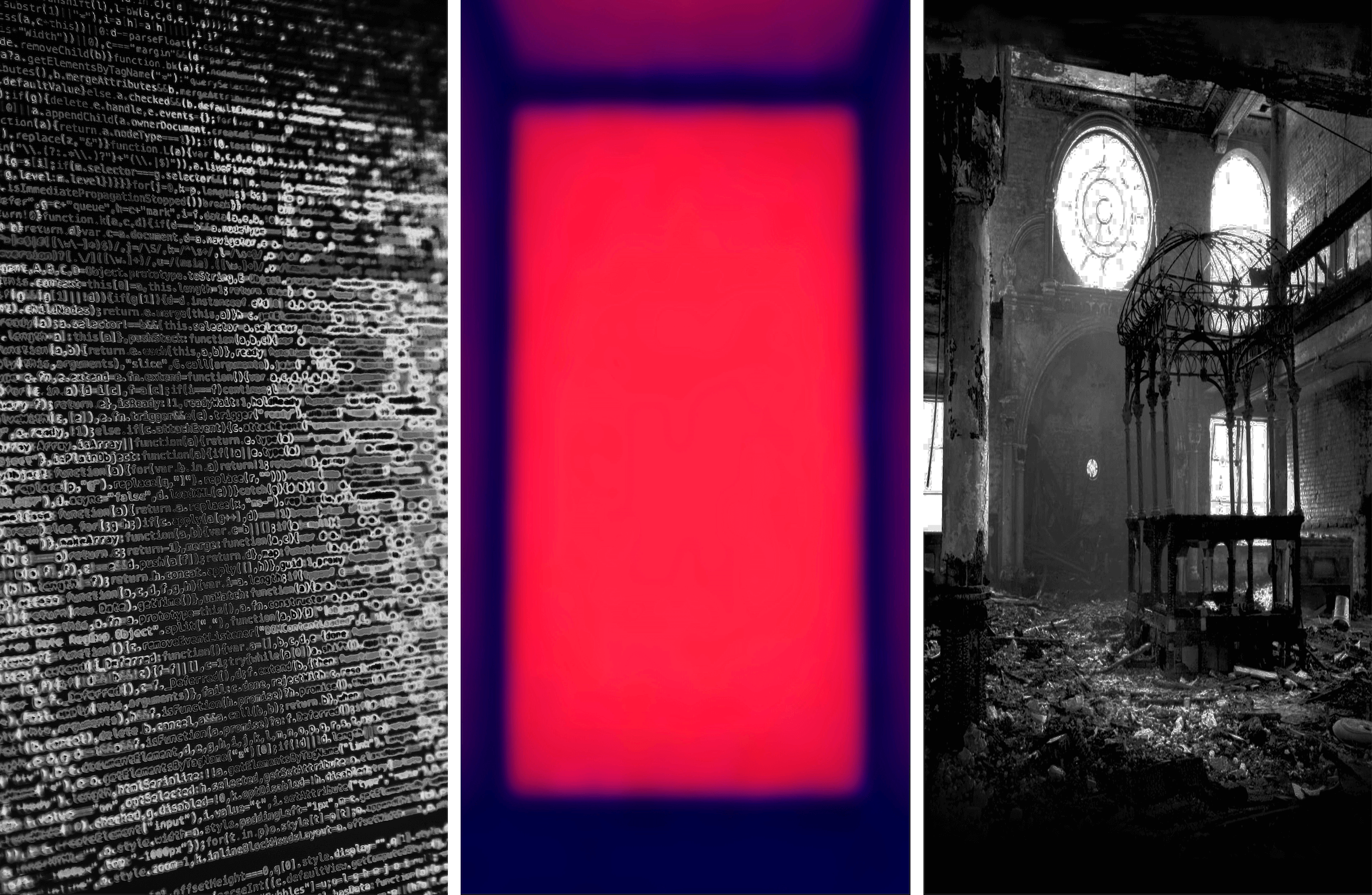Im Hause Kafka las man nicht
Sonntag, 7. Januar 2018, begleitet von Beniamino Gigli, der eine Sammlung von Arien singt.
…
Es ist ein Riß
in der Welt, von der Mitte
zum Rand. Laß uns gehn. Komm,
gib mir die Hand. …
(aus Werner Söllner: Schwift Code)
In diesem Moment beginnt Gigli mit der Arie „Fra poco a me ricovero“ aus Donizettis Lucia, – das glaube ich zwar nicht, aber die Musik und vor allem Giglis Stimme ist natürlich immer ein großer Trost. Aber wer kann das überhaupt von sich sagen, dass er behütet, geschützt sei? Zuflucht habe.
Zumindest Kindern würde man solch ein Beschütztsein ja wünschen, aber für die meisten von uns gilt wohl eher der bitter ironische Reim von W. H. Auden „Gib jedem Kind auf seinem Weg soviel Neurose, wie’s erträgt.“ Nun, es ist sowieso die Frage, wohin wir gekommen wären, hätten wir alle eine glücklich behütete Kindheit gehabt; vermutlich wären wir dann allesamt einfach glückliche, geldverdienende Konsumenten geworden, von nichts gequält, als von dem mitunter zu schlechten Urlaubswetter oder irgendwelchen Sicherheitslücken beim letzten Betriebssystem-Update.
Aber wäre das so schlimm? Ich denke nicht, die meisten wären es zufrieden und würden sich bei der Lektüre meines Textes hier längst fragen, wovon ich eigentlich rede. Und die Gegenbeispiele sind ja nicht gerade erstrebenswert. Franz Kafka war so eines. In der intelligenten Rezension, die Klaus Bellin über Reiner Stachs Kafka Biographie geschrieben hat, lese ich:
„Noch nie sah man das Kind und den Jüngling Kafka so deutlich wie hier, einen schmalen Jungen mit leicht abstehenden Ohren, der früh lernen musste, mit der Einsamkeit fertig zu werden, der nicht auf die Straße durfte wie andere, immerzu in der Stube, immer unter Kontrolle, bedroht vom herrischen Vater, seinen Launen, seinen Ausbrüchen. Noch der Achtzehnjährige, der zum Lohn fürs bestandene Schulexamen zum ersten mal ohne Eltern reisen durfte, musste sich die Beaufsichtigung durch einen Onkel gefallen lassen. Schön war es überhaupt nur in den Sommerwochen, wenn es an die See ging und der Vater nach einiger Zeit zurück nach Prag musste, um nach seinem Galanterie-Geschäft zu sehen. Sonst blieb dem Sohn nur eine Möglichkeit, dem Zorn Hermann Kafkas zu entgehen: ihm nachplappern, beipflichten, sich selber gründlich verleugnen, den dressierten Affen geben, wie er’s selber nannte.
 Das Kind hat schon früh nach einer Strategie gesucht, dem Ungemach zu begegnen. Es lernte, Gesten, Stimmung, Worte, Bewegungen des Vaters zu deuten und sich darauf einzustellen. Die scharfe Beobachtungsgabe, die Kafka in seinen Texten offenbart, sagt Reiner Stach, ist bereits in den frühen Jahren entwickelt worden. Der Junge, der ständig auf der Hut sein musste, versuchte, sich unsichtbar zu machen. Er sonderte sich ab, war selig, als er noch vor dem Eintritt ins Gymnasium nach einem Umzug der Familie zu einem eigenen Zimmer kam mit einer Tür, die man schließen konnte. „Es war vielleicht das wichtigste Geschenk“, meint Stach, „das Kafka in seinem Leben empfing.“ Irgendwann suchte er Zuflucht in der Lektüre. Im Hause Kafka las man nicht.“
Das Kind hat schon früh nach einer Strategie gesucht, dem Ungemach zu begegnen. Es lernte, Gesten, Stimmung, Worte, Bewegungen des Vaters zu deuten und sich darauf einzustellen. Die scharfe Beobachtungsgabe, die Kafka in seinen Texten offenbart, sagt Reiner Stach, ist bereits in den frühen Jahren entwickelt worden. Der Junge, der ständig auf der Hut sein musste, versuchte, sich unsichtbar zu machen. Er sonderte sich ab, war selig, als er noch vor dem Eintritt ins Gymnasium nach einem Umzug der Familie zu einem eigenen Zimmer kam mit einer Tür, die man schließen konnte. „Es war vielleicht das wichtigste Geschenk“, meint Stach, „das Kafka in seinem Leben empfing.“ Irgendwann suchte er Zuflucht in der Lektüre. Im Hause Kafka las man nicht.“
Wenn Sie ein Rezept suchen, wie man Schriftsteller macht. Hier ist es. Unterdrücken Sie ihr Kind, geben Sie ihm soviel Neurose wie möglich auf den Weg, und dann, kurz bevor es daran zerbricht, lassen Sie es in der Lektüre den lebensrettenden Ausweg der Literatur entdecken. Denn eben das ist die Literatur, ein Weg, um sich das Leben zu retten. Wenn Sie die Literatur für etwas anderes benutzen, dann brauchen Sie sie in Wahrheit gar nicht.
Ganz einfach, eigentlich, oder? No courses in creative writing necessary. Und umgekehrt können Sie natürlich auch die Gegenprobe machen. Will sagen, wenn Sie ein Kind haben, das nicht liest, dann seien Sie darüber bitte nicht sauer. Sie haben vielleicht einfach nur ein Kind, das mit seinem Handy glücklich ist, so dass es keine neurotische Flucht ins Lesen und mögliche spätere Schreiben braucht. Seien Sie froh. Glückwunsch.
Haben Sie noch einen schönen Sonntag
Herzlich, Ihr PHG