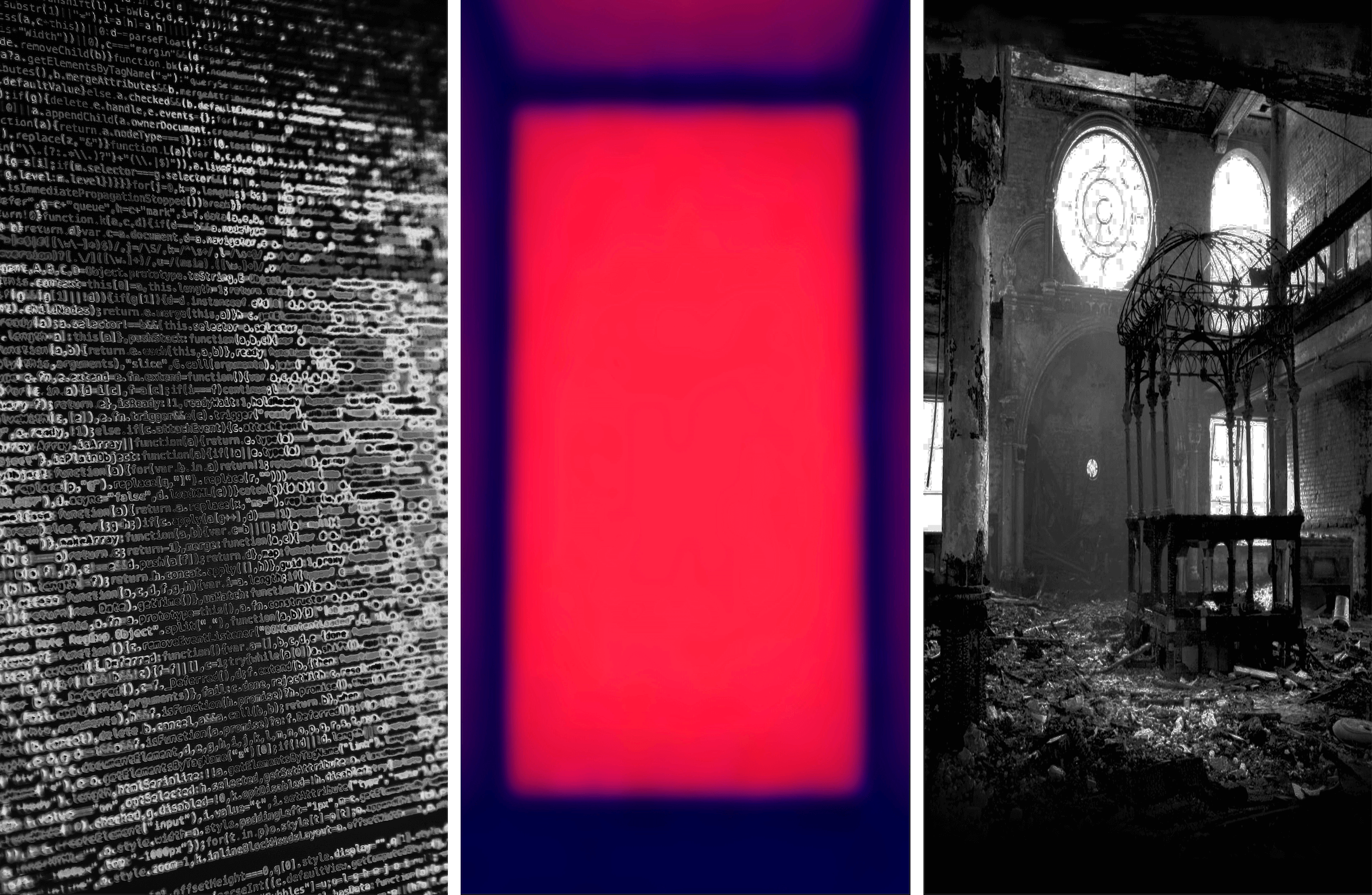Gestern ein Erschrecken, heute ein Romananfang
Venedig, 7. November 2017, bei den Klavier-Konzerten 20 + 23 von Mozart mit Arturo Benedetti Michelangeli (aus Trotz, des so ganz anderen Themas wegen)
„Der Mensch kann mit dem
Menschen alles machen.“
Witold Gombrowicz: Tagebuch
Die Liebste und ich saßen gestern noch spät beim Tee, sie ging die aufgelaufene Post durch, die seit zwei Wochen darauf wartete, geöffnet zu werden. Darunter auch der Prospekt eines Reisebüros, deren Betreiber wir kennen. Sie hatten ihn uns geschickt, weil sie wussten, dass wir uns für eine Polen-Rundreise interessieren, in deren Verlauf auch das Konzentrationslager Auschwitz besucht werden soll. Wir sprechen bald seit drei Jahrzehnten darüber, dass wir nach Auschwitz müssen, sollten … ach, seit wir uns kennen. Anfangs hatte ich es abgelehnt, ganz rigoros abgelehnt, dahin gehe ich niemals, das hatte ich immer wieder mit einer wütenden Verzweiflung gesagt. Aber du schreibst immer wieder über den deutschen Faschismus, hatte die Liebste geantwortet, du beschäftigst dich ständig damit. Darum werde ich trotzdem die deutschen Mördergruben und Schlachthäuser nicht besuchen, es reicht zu wissen, dass es sie immer noch überall gibt.
Sie hat mich nie zu sehr bedrängt, obwohl sie mich natürlich an meine Widersprüche erinnerte: Hatte ich nicht z.B. einen Dokumentarfilm über die Maler im KZ Theresienstadt geschrieben? Ja, das hatte ich. War ich nicht in Tschechien gewesen und hatte dort den Ort des Lidice-Massakers angeschaut? Ja, das hatte ich, in meinem ersten Roman „Seelenlähmung„ hatte ich darüber darüber geschrieben. Und es hatte mich fast umgebracht.
Nach der Wiedervereinigung lebten wir beide nahe der ehemaligen Grenze zur DDR, im Hannoverschen Wendland, und fuhren auch nach Weimar, besuchten das KZ Buchenwald auf dem Ettersberg, standen selbst in der engen Erschießungskammer, in der die Tür eine kleine Klappe besitzt, durch die man den Genickschuss erhielt. Zum Buchenwald-Besuch hatte ich meine Einwilligung gegeben. Zu Auschwitz sagte ich immer noch, auf keinen Fall. Später machten wir eine lange Reise durch das Elsass und besuchten auch das ehemalige KZ Struthof Natzweiler. Auschwitz wollte ich noch immer nicht sehen. Die Vorstellung, nach Auschwitz zu gehen, war mir körperlich unmöglich. Und dann erzählte die Liebste vor einigen Monaten, dass Scheifele-Reisen diese Polentour anbieten wollten und sie gefragt hätten, ob wir daran interessiert wären. Allein werden wir, sagte sie, diese Reise niemals schaffen. Und nach Auschwitz werden wir nicht mehr kommen, wenn wir die Gelegenheit nicht wahrnehmen. Du weißt, wie das mit Israel gewesen ist. In Israel hatten wir auch die Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem besucht, wo ich die Namen all der Gogolins fand, die laut der dortigen Datenbank in der Shoah deportiert und getötet wurden. Ich habe eine Kleinigkeit hier im BLOG darüber geschrieben, anlässlich der Neuauflage meines Romans „Kinder der Bosheit„.
Gut, sagte ich, du hast recht, dann fahren wir nächstes Jahr nach Auschwitz.
Und während wir dann gestern den Prospekt durchgingen und uns entschieden, auf alle rein touristischen Teile der Reise zu verzichten (auf die Besichtigung von Salzbergwerken etwa), um mehr Zeit für die Städte und Auschwitz zu haben, da setzte ich mich an den Computer, rief erstmals in meinem Leben die Webseite der KZ- Gedenkstätte auf, trug in die Suchmaske meinen Namen ein und fand — meinen Vater.
Nun, es ist natürlich nicht mein Vater, es ist vielmehr der Häftling mit der Gefangenen-Nummer 20743. Aber er trägt den Namen meines Vaters. Der Schreck saß tief, obwohl ich sofort sah, dass dieser Edmund Gogolin bereits am 13. November 1941 in Auschwitz ermordet worden war. Und der Edmund Gogolin, der mein Vater werden sollte, war zu diesem Zeitpunkt erst 14 Jahre alt und hat bis vor 10 Jahren gelebt. Mein Vater war also jünger, er wurde erst am 14. Oktober 1927 geboren, während sein Namensvetter am 12. September 1910 geboren wurde. Aber sie stammten von dem gleichen Fleckchen Erde, das ich mir heute mit Google-Earth ansehen kann.
Der 1941 in Auschwitz I – Block 11 ermordete Edmund Gogolin wurde in Rypalki geboren, das liegt im Kreis Rippin (Rypin). Alle meine Vorfahren, soweit sie nach dem Krieg auf ihrer Flucht den Westen erreichten, geben Rippin als ihren Heimatkreis an. Von Rippin nach Rypalki sind es laut Google Earth gerade mal 5,4 Kilometer; der Weg, so sehe ich, führt über eine mit mageren Alleebäumen bestandene Straße, die schnurgerade zwischen Felder verläuft, hin und wieder unterbrochen durch kleine Gehöfte und einzeln stehende Häuser. Rypalki scheint ein solches Gehöft zu sein. Ein kräftig ausschreitender Mensch kann die Strecke in einer guten Stunde bewältigen.

Auf diesem Bild steht der ganze übriggebliebene Clan, der um meine Großmutter Auguste gescharrt ist, bereits in Ahrensbök, Ost-Holstein. Der große Kerl rechts hinten ist mein Vater. Wo sein eigener Vater geblieben ist, gab die Familie stets an, nicht zu wissen.
Obwohl mindestens eine Tochter nicht dabei ist, weil sie sich aus Liebeskummer das Leben genommen hatte, stehen da immer noch acht Kinder um meine Großmutter herum. Sie ist die Schmächtigste von allen auf diesem Bild, als habe sich ihre Körpersubstanz auf ihre Kinder verteilt. Aber das wird ihr recht gewesen sein. Von ihr stammt der Satz: „Egal wie dreckig es einem geht, Hauptsache man lebt.“
Die gelb markierte Namensliste stammt aus dem Buch „Nach Flucht und Vertreibung – Ein neuer Anfang in Ostholstein„. Eine Dokumentation des BdV für die ehemaligen Kreise Eutin und Oldenburg in Holstein.
Der letzte auf dieser Liste bin ich selbst ‚VdK (Vorname des Kindes) Peter (3.1.50)‘, steht da, als Kind von Edmund, der am 7.9.46 aus russischer Gefangenschaft kam, und der Holsteinerin Hilde, geborene Scheel, Umsiedlung dieser drei 1951 nach Westfalen. Ich kann ergänzen: nach Castrop-Rauxel, später dann Dortmund. Inzwischen sind meine Eltern beide tot, der Vater seit 10, die Mutter seit 2 Jahren.
Tja, das brachte mir gestern meine Zustimmung, nach Auschwitz zu fahren, wogegen ich mich jahrzehntelang gesperrt hatte. Als habe dieser zum Glück falsche Edmund Gogolin all die Jahre dort auf mich gewartet. Nun ist er auf meiner permanenten Totensuche vor mich hingetreten.

Und ich weiß, dass ich den Block 11 in Auschwitz I werde suchen und betreten müssen, so das noch möglich ist. Ein wohl historisches Bild existiert in den Datenbanken der Gedenkstätte noch.
Aber wie soll ich mich demgegenüber verhalten? Sicher, bei 1000 Leuten, denen das passiert wäre, käme von 999 vermutlich ein Schulterzucken, verbunden mit einem „Wen juckt’s?“ Man kann sich immer damit salvieren, dass das purer Zufall sei, Schall und Wahn, der nichts bedeutet. Aber ich bin nun mal erstens Schriftsteller. Und zweitens natürlich unter tausend der, den es juckt. Also muss ich mich damit befassen. Auch auf die Gefahr hin, dass am Ende wieder mal ein Buch daraus entsteht, das niemand haben will.
Und habe ich nicht in Wahrheit längst damit begonnen? Es gibt da den längeren Anfang eines Romans, der den Arbeitstitel „Die Konzessionen des Herzens“ trägt, seit Jahren irgendwo auf der Festplatte herumliegt und so beginnt:
Kapitel 1
Von den Ahnungslosen, mit denen die Welt überfüllt ist, hört man oft den Ausspruch, der Rest sei Geschichte. Das ist natürlich Unfug, denn Geschichte ist das Ganze. Und sie geht mitten durch das Herz der Menschen hindurch; manche Herzen gehen daran zu Grunde.
Meinen älteren Bruder habe ich wegen dieses Restes niemals von Angesicht zu Angesicht kennen gelernt. Er starb, kaum drei Monate alt, in einem Backofen, während draußen auf dem Hof meiner Großmutter die SS im Schnee stand und darauf wartete, dass der gesuchte polnische Zwangsarbeiter die von ihnen angesteckte Scheune verließ, um sich erschießen zu lassen. Die Scheune brannte nieder, ohne dass der Zwangsarbeiter daraus zu fliehen versuchte, was der SS, die zuvor den Hof von den Kellern bis zum Dach durchsucht hatte, am Ende genügte. Mit der Scheune verbrannte beinahe der alte Apfelbaum, den meine Großmutter den Schandbaum nannte. Und als die Brandstifter gegen Morgen abzogen, war mein Bruder hinter der Ofenklappe erstickt. Ich habe ihn Laurents genannt, das scheint mir angemessen.
Der Zwangsarbeiter hieß Jan, Jan Androwski. Er überlebte zwischen zwei dünnen Wänden, die das Haus und den Hühnerstall voneinander trennten, und er sollte mein Vater werden.
Für meinen künftigen Vater war diese Flucht bereits die dritte. Gerade mal zwanzig Jahre alt, war Jan Androwski bis zum schneereichen Januar 1945 längst ein Meister des Fliehens geworden, die Orte und Identitäten wechselnd, als habe er nie etwas anderes getan. Aber natürlich war das nichts Äußerliches, das ihn unbeschadet gelassen hätte. Geschichte ist niemals äußerlich. Ich hätte ihm gewünscht, dass Wagner Recht hat, wenn er Alberich in der 3. Szene des Rheingolds sagen lässt »Dem Haupt fügt sich der Helm«. Aber wie so oft, lügt Wagner auch hier, denn es ist genau umgekehrt.
Aber stopp, das kommt alles noch, dafür ist noch lange genug Zeit. Ich will mir nicht von Irina, meiner Muse, perfekten Probeleserin und vermutlich baldigen Arschputzerin sagen lassen müssen, dass ich ein alter Kerl bin, der nicht mehr weiß, in welcher Reihenfolge die Dinge passiert sind, und der deshalb seine Zuhörer verwirrt.
»Warum steckt deine Mutter deine Bruder in Feuerofen?« fragte sie gestern vorwurfsvoll. »Sie hat deine Bruder gemordet.«
»Irena, Schatz«, sagte ich, »das hat meine Mutter zwar selbst geglaubt …«
»Sag nicht Schatz«, unterbrach Irena prompt, »für Schatz du bezahlst höhere Preis.«
»Gut, also nicht Schatz.« Sie lachte sofort. »Aber stell dir vor. Es herrscht Krieg. Es ist tiefer Winter. Die Kälte steht in allen Räumen außer in der Küche, denn nur dort wird geheizt. Und es ist einer dieser damals typischen Küchenherde, ein Monstrum mit einer riesigen gusseisernen Kochplatte, rundum weiß emailliertes Blech. Hast du so etwas schon mal gesehen?«
»Ich erinnere«, sagte Irina.
»Vorn gibt es außer der Tür, durch die man die Kohlen nachfüllt …«
»Deutsche Kohlen in Krieg war gestohlen von Polen«, unterbrach Irina mich.
»Nein«, sagte ich, »da irrst du dich. Wenn es gestohlene Kohle war, dann wahrscheinlich eher aus der Sowjetunion.«
»Sowjet Kohle auch gestohlen von Polen«, sagte Irina.
So ging es eine geschlagene Viertelstunde hin und her, bis ich ihr endlich erklärt hatte, dass es auf der Vorderseite dieser Küchenherde auch Klappen für die Backröhre und zwei Warmhaltefächer gab, in die die Leute alles reinstellten, was warmgehalten werden musste. Von der Kaffeekanne am Morgen bis zum Topf mit der restlichen Suppe für den nächsten Tag.
»Deine Familie hat getrunken Kaffee? In Krieg?« fragte Irina.
»Keinen echten Kaffee, Irina, Gott bewahre, keinen Bohnenkaffee. Muckefuck. Nur Muckefuck.«
Das Wort kannte sie nicht. Und ich sah, dass sie mir nicht traute. Vielleicht auch, weil ich Gott und Bohnenkaffee in einem Atemzug genannt hatte. Am Ende habe ich es trotzdem geschafft, ihr zu erklären, dass auch die Säuglinge über Tag in der Backröhre warmgehalten wurden, wenn es im Haus zu kalt war. Nur nachts nahm man sie mit in die Betten.
»Und warum hat deine Mutter nicht rausgenommen, bevor ist getötet, deine Bruder?«
»Weil die drei Frauen von der SS in der Speisekammer eingesperrt worden sind, damit die in Ruhe das Haus durchsuchen und plündern konnten. Und jemand von der SS muss auch die Klappe am Herd geschlossen haben. Denn das hat meine Mutter natürlich nicht getan, obwohl sie selbst es danach ihr ganzes Leben lang geglaubt und sich vorgeworfen hat.«
Irina misstraute mir. Ich sah es an ihren Händen, an ihren Schultern, an ihren Mundwinkeln, an ihrem Blick. Vermutlich glaubte sie, dass ich es selbst getan hatte, dass ich der Mörder meines Bruders war, obwohl Jan Androwski mich damals noch gar nicht gezeugt hatte.
»Wird haben geschrien, deine Bruder«, sagte Irina nach einer langen Pause.
»Bestimmt«, sagte ich, »aber Gott hat ja bekanntlich keine Ohren.«
Irina verließ wortlos das Zimmer. Mein Meinung von Gott wird von ihr augenscheinlich nicht gebilligt.
Ich habe ihr das nicht übel genommen. Ich weiß, dass Irinas ungläubige, abweisende Reaktion eine gute Vorbereitung auf das ist, was mir bevorsteht, wenn ich diese Aufzeichnungen eines Tages abgeschlossen haben werde und sie veröffentliche. Aber wenn ich die seltsame Geschichte meiner Kindheit nicht niederschreibe, dann wird Laurents niemals eine Stimme haben; dann wird er weiter schreien, ohne dass jemand ihn hört. Das will ich nicht. Ich glaube, Irina wird das verstehen. Außerdem muss ich mich endlich von ihm befreien. Das ist sogar der wichtigste Grund meines Schreibens. Denn seit dem Tag, da auf dem staubigen Dachboden in der Stahlwerkstraße die sonst so wachsame Selbstkontrolle meiner Mutter versagte und sie mir von Laurents, der damals noch nicht so hieß, erzählte, ist mir, als wenn ganz nahe bei mir jemand dahin schreitet, den ich nicht sehe. Das muss aufhören.
Mein Geruchssinn ist so eng mit dem Gehör und dem Bildergedächtnis verbunden, dass jeweils das eine das andere wachruft. So erinnere ich, während auf meinem CD-Player gerade der 3. Akt der Walküre mit seinem Hojotoho! beginnt, den Geruch der Probebühne wieder, auf der wir fast ein ganzes Jahr lang Wagners Ring einstudiert haben.
Obwohl Irina natürlich weiß, dass ich Opern-Regisseur bin, versteht sie nicht, dass ich des Nachts, während des Schreibens, ständig den Ring höre. Und im Grunde hat es auch weniger mit meiner Profession zu tun, als mit dem Umstand, dass nur die unglaubliche Geschichte des Wagnerschen Rings mit ihren Zwergen und Riesen, Wasser- und Luftgeistern, Göttern und Menschen, die angemessene Musik sein kann, die mich bei der Niederschrift meiner Familiengeschichte begleitet.
»Wann hast du gewusst, was in der Haus ist passiert?« hat sie mich gefragt.
»Eigentlich immer. Es war bei mir wie ein großer dunkler Fleck, wie ein ewiges Gewitter mit schwarzen Wolken, über mir, hinter mir, in mir.«
»Und warum du schreibst jetzt über der Gewitter? Du bist schon eine alte Mann.«
»Ich bin 72 Jahre alt, Irina, aber ein alter Mann bin ich nicht. Läppische 72 Jahre. Karajan ist 81 Jahre alt geworden, Celibidache 84, Toscanini 90.«
»Waren alles Dirigenten gewesen. Sie nicht Dirigent, Herr Zygmunt«, sagt Irina ungerührt. »Warum erst jetzt?« Wenn sie vom Du zu Herr Zygmunt wechselt, weiß ich, dass ich dabei bin, sie zu verärgern.
»Das meiste, Irina, habe ich schon als Kind gewusst. Aber die Gespenster, die in einem Kinderkopf wohnen, sind viel zu groß, um aus der kleinen Öffnung des Mundes heraus zu finden.«
Ich verrate ihr nicht, dass die Gespenster in meinem Kopf immer noch so groß sind wie in der Kindheit.
—–
Gut, das ist vielleicht ein halbwegs brauchbarer Anfang. Vor allem deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass mein armer doppelter Vater schon drinsteckt in dieser Geschichte.
Schaun wir mal, wer weiß schon, wohin das führt. Und falls es zu etwas führt, was ich noch keinesfalls versprechen kann, dann werden Sie, weil Sie hier im BLOG gelesen haben, von Anfang an dabei gewesen sein. Wer kann das schon von sich sagen!
Bleiben Sie glücklich
wünscht Ihnen PHG