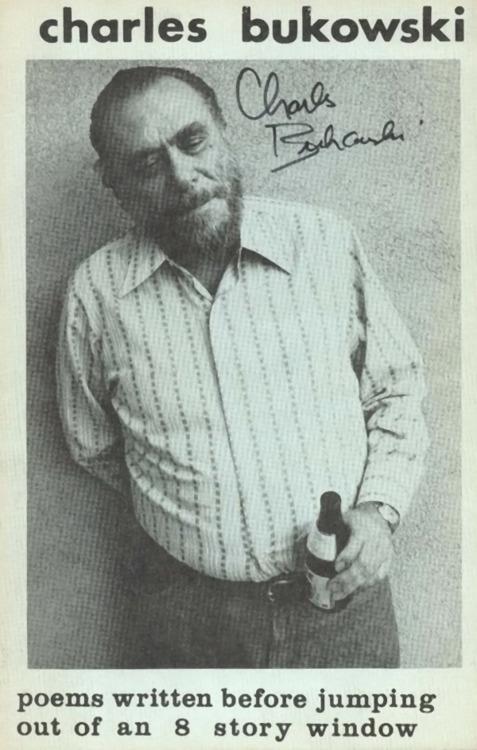Die Gefahren der Literatur
Berlin, Dienstag, 12. Juli 2016, bei offener Balkontür, leichtem Wind und Georg Friederich Händels Jugendwerk "Agrippina", dieser metaphorischen Oper, in ihrer "verworfenen" Urfassung
Die großen Meisterwerke der Literatur sind gefährlich, sie führen den Leser mitunter an Orte, von denen man niemals ganz zurückkehrt. So habe ich seit meiner ersten Lektüre von José Lezama Limas »Paradiso« – es muss um 1980 herum gewesen sein – niemals wieder das mitternächtlich dunkle Zimmer verlassen, in dem der fünfjährige José Cemí zu Beginn des Buches gegen sein Asthma kämpft und Baldovina den Ausschlag, der seinen Körper bedeckt, mit Alkoholabreibungen und heißem Kerzenwachs zu lindern trachtet. Ja, ich meine das ganz ernst. Ich fühlte mich, als ich dieses Buch las, das so viele Leser für viel zu schwierig halten, von der ersten Seite an in dem Geschehen selbst anwesend. Wie eine Art unsichtbarer Beobachter und Mitleidender. Und ein Teil von mir, hat dieses Buch nie wieder verlassen.
Nun gut, es geht mir durchaus auch mit anderen Büchern so. Ich kann mich an den Mannschen »Zauberberg« ebenso erinnern, als sei ich dabei gewesen, sehe und höre Madame Chauchat türenschlagend den Essraum betreten, mit »ihren ewig mistigen Füßen«, höre Settembrini seine Vorträge halten und erinnere mich an Hans Castorps Visionen bzw. Alpträume im Schneekapitel, als hätte ich sie selbst ertragen müssen. Prousts Ich-Erzähler während der Sommerferien in Balbec (1); Cincinnatus C. im Kerker, nachdem ihm im Flüsterton das Todesurteil mitgeteilt wurde (2), in diesem Buch, das der Autor selbst mit dem Spiel einer Violine im Leeren verglichen hat, und das in meiner inneren Bibliothek in dem Regal steht, darin ich die imaginären Fluchten versammelt habe, neben Kafkas »Schloss« und den Ereignissen auf der Brücke am Eulenfluss (3), Arnos »Gadir« und dem großen »KAFF« (4); mit Marlow ins Herz der Finsternis (5) fahren, um zu begreifen, dass das Leben ein dunkler Wald ist, in dem niemand den Weg kennt; mit Addie Bundren auf dem Weg zur Beerdigung sein (6); mit dem Mädchen in dem Dauphine und all den anderen auf der südlichen Autobahn festsitzen (7) oder mit Bernard die Kuh im Sjunkarmoor sehen und die Bienen hören, die in dem Kopf des Vogts summen, auf der stinkenden, ekelhaften Behindertentoilette unten beim Flogstabad (8) – ja, all diese Szenerien und mehr wohnen in dem Palast, der mein Kopf ist. Ich kann mich in ihnen bewegen wie in den Straßen von Rom, wo ich vor Jahrzehnten lebte, wie in den Straßen meiner Kindheit um den Dortmunder Borsigplatz.
Warum ist das so? Nur, weil ich vielleicht ein besonders ausdauerndes Gedächtnis habe? Gewiss nicht. Ich bin ganz sicher, dass es an der Literatur selbst liegt, die sich mir eingeschrieben hat. Denn ich habe natürlich wie jeder andere auch tausend und einen Kriminalromane gelesen, von denen ich nichts erinnere. Keine der obligaten schwedischen Leichen oder ihre Brüder und Schwestern aus der deutschen Provinz haben sich mir eingeprägt, kein Schauplatz ist mir geblieben, kein Name einer Hauptfigur belastet mein Namensgedächtnis, während ich Julien Sorel (9), von dessen Schicksal ich mit siebzehn las, immer noch kenne. Warum also segeln Alfred Tutein (10) oder auch Justine, Balthazar, Mountolive und Clea (11) immer noch auf dem weiten Meer meiner Erinnerung und werden erst bei meinem Tod untergehen, während all die Donna Wallanders und ihre deutschen Klone naturgemäß niemals den Ereignishorizont der schwarzen Löcher verlassen konnten, in denen sie geschrieben und publiziert wurden?
Der Grund liegt darin, dass wirkliche Literatur etwas tut, was kaum noch jemand weiß und will. Sie lässt den Leser nämlich echte Erfahrungen machen. Statt ein paar Stunden Unterhaltung und Zeitvertreib anzubieten, beansprucht Literatur etwas, sie verlangt nämlich durchlebt zu werden. Das ist eine Folge ihrer unauflösbaren Komplexität und schweren Zugänglichkeit, für die Sprache, Konstruktion und Stil eines Textes verantwortlich sind. Literatur gleicht darin dem wirklichen Leben, das ja eben auch nicht aus Unterhaltung und leicht auflösbaren Scheinproblemen besteht, auch wenn uns die Werbung das einzureden versucht. Das Leben muss durchlebt und oft genug auch durchlitten werden. Und gerade aus den durchlittenen Lebensabschnitten erwächst dann die Erfahrung und Erinnerung, die die Identität eines Menschen ausmachen. Solche Literatur, solche Kunst wird dann auch zur Identität des Menschen, der sie gelesen hat, während die ständig wechselnden Wellen, die über die Büchertische der Großbuchhandlungen schwappen, nichtmal die Kraft haben, den Schaum der Tage zu bereichern.
Aber darüber klagen längst nur noch solche Fossilien wie ich – einige gibt es noch -, während der ganze übergroße Rest nur mit den Schultern zuckt. Okay, werden Sie sagen, wir machen also beim Lesen keine Erfahrungen mehr? Wir verbringen nur irgendwie unsere Zeit? Na und? Wen juckt’s?
Gegen »na und?« gibt es kein Argument. Darum höre ich jetzt auch hier auf. Ich wünsche Ihnen noch ein paar locker flockige Tage. Bleiben Sie glücklich, sagt Ihr PHG
—–
(1) Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (2) Vladimir Nabokov: Einladung zur Enthauptung (3) Ambrose Bierce: Die Brücke am Eulenfluss (4) Arno Schmidt: Gadir + KAFF auch Mare Crisium (5) Joseph Conrad: Herz der Finsternis (6) William Faulkner: Als ich im Sterben lag (7) Julio Cortázar: Südliche Autobahn (8) Lars Gustafsson: Die dritte Rochade des Bernard Foy (9) Stendhal: Rot und Schwarz (10) Hans Henny Jahnn: Fluss ohne Ufer (11) Lawrence Durrell: Die vier Bände des ›Alexandria-Quartetts‹