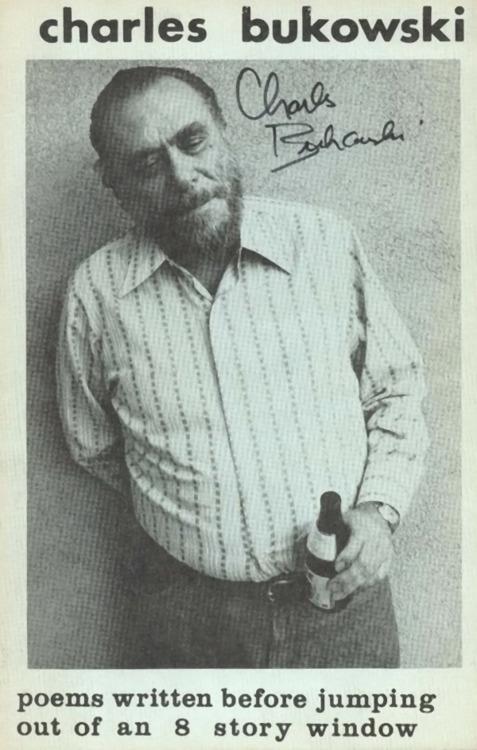HOUSE OF LEAVES – Neuer Anlauf
Wiesbaden, Samstag, 26. Januar 2013, mit Puccinis "La Fanciulla del West" mit Mara Zampieri und Placido Domingo unter Lorin Maazel in einer Inszenierung des Teatro alla Scala (auf dem Schirm neben mir).
Kurz, obwohl ich hier ja über
D A S H A U S
schreiben möchte, einige Worte zur Oper, die ich gerade höre. Puccinis Oper „La Fanciulla del West“ ist ganz sicher Puccinis bestes Werk. Ich sage das, obwohl ich sie selbst bisher eher weniger im Blick hatte, was freilich an der so selektiven Aufführungspraxis liegt. Die Butterfly, Tosca natürlich und La Bohème sowieso, aber auch noch Turandot stehen absolut im Vordergrund. La Fanciulla del West wird weit seltener aufgeführt und – jetzt leiste ich Abbitte – ich hatte mich zudem lange Zeit von der Story der Oper ablenken/irreleiten lassen. Eine Oper, die im ‚Wilden Westen‘ während des Goldrausches spielt, was kann das denn eigentlich sein? Ist das überhaupt ein Stoff für eine Oper? So spießerhaft habe ich gedacht, obwohl ich andererseits Dutzende von Opern gehört hatte, ohne mich überhaupt sonderlich um den Inhalt zu kümmern. Natürlich ist der Stoff von „La Fanciulla del West“, der auf Belascos Stück „The Girl of the Golden West“ basiert, ein Opernstoff! Und was für ein großartiger Stoff es ist, was für einen musikalischen und auch dramaturgisch überwältigenden Eindruck diese Oper hinterlässt, das müssen Sie selbst hören! Aber damit soll es vorerst genug sein, denn ich beabsichtige keine Opern-Besprechung. Obwohl es mich unglaublich reizt! Dick Johnson (Placido Domingo) soll gerade gehenkt werden – wer hat angesichts des Strangs je derart überwältigend schön und kraftvoll gesungen? Man erschaudert, wenn er die mit Stricken gebundenen Hände hebt und nur „Bella Donna“ singt.
Aber nun doch endlich zu
D A S H A U S !
Ende August 2007, das Buch kann kaum mehr als einige Tage auf dem Markt gewesen sein, kaufte ich in der Mainzer Dom-Buchhandlung auf einem meiner Streifzüge den Roman „Das Haus – House of leaves“ von Mark Z. Danielewski. Vom Autor hatte ich noch nie etwas gehört, was freilich nicht verwunderlich ist, da „Das Haus“ sein Erstling ist, der 2000 in New York erschien und nun 2007 in der Übersetzung von Christa Schuenke und Olaf Schenk bei Klett-Cotta erschien.
Es ist ein etwas großformatiges Werk, besitzt fast 800 Seiten Umfang und fiel mir beim Durchblättern außerdem sofort deshalb auf, weil es typografisch gänzlich aus dem Rahmen fällt; aus dem gegenwärtigen freilich nur. In einer amazon-Rezension heißt es, es handele sich um „einen beispiellosen overkill typographischer Besonderheiten, von winzigen Fußnoten bis zu Textkästen in Spiegelschrift.“

Verschiedene Textebenen, die auch in unterschiedlichen Schrifttypen gesetzt sind, wechseln miteinander ab, der Text wird ständig durch Fußnoten kommentiert, als wolle er einen quasi wissenschaftlichen Charakter behaupten, wobei die Tatsache, dass die meisten Fußnoten von einem augenscheinlich ziemlich durchgeknallten Acid-Head stammen, dem wissenschaftlichen Anstrich auf erfrischende Art und Weise widerspricht, dazu ist das Buch durchsetzt von unterschiedlichstem Bildmaterial und drucktechnischen Absonderlichkeiten, deren Sinn beileibe nicht unbedingt einzusehen ist. Wenn man dann noch dazurechnet, dass die Schreibweise in einer der Textebenen sich stark umgangssprachlich geprägt zeigt, sodass z.B. aus einem „eigentlich“ ein „einklich“ wird, so wird vielleicht verständlich, dass ich mich gleich seltsam an Textmerkmale der Werke Arno Schmidts erinnert fühlte. Ich fand das absonderlich genug, zumal es ja eindeutig so ist, dass Arnos Schmidts höchst artifizielle und innovative Schreibweise nie Nachfolger gefunden hat, sodass sie, denkt man von der literarischen Technik her, wie eine Sackgasse aussah. (Ich weiß, dass ich hier Autoren wie Roggenbuck und Jirgel unterschlage, aber dazu vielleicht an anderer Stelle.)
Nun, wie auch immer, mochte „Das Haus“ auch den Eindruck erwecken, als habe der Arno Schmidt des Spätwerkes sich entschieden, eine Neufassung von William S. Burroughs‘ „Naked Lunch“ schreiben zu wollen, aufgefüllt mit den Werken dutzender anderer Autoren des 20. Jahrhunderts, denn selbstverständlich zitiert Danielewski unentwegt, wobei Rilke und Heidegger vielleicht nur zwei extreme Wegmarken sind, die der Autor zitierend passiert.
Kann das alles sein, dachte ich, ist das tatsächlich ernst gemeint? Oder ist es ein Witz? Ein Medien-Gag, eine Verirrung, ein Unfug, der nichts anderes spiegelt, als die Maßstabslosigkeit und den Erinnerungsverlust der Gegenwart? Nun, ich kaufte das Buch, trotz des horrenden Preises von 29,90 Euro und begann erwartungsvoll mit der Lektüre, die ich dann nach etwas über 30 Seiten erstmal abbrach. Was war das? Eine Geschichte auf jeden Fall, die etwas schwer in Gang kam, Seltsamkeiten und Bedrohungen behauptete, wo man sie als Leser nicht empfand bzw. wo sie einem nicht wirklich vermittelt wurden. Ich denke mal, dass den Leser hier entweder der Ehrgeiz packen muss, oder dass er aus dem Buch aussteigt. Entsprechend sind auf den amazon-Seiten für gebrauchte Bücher inzwischen auch schon viele Dutzende verbilligt zu bekommen, was in der Regel nach so kurzer Zeit nicht passiert.
Heute nun gab ich dem Buch eine zweite Chance, vor allem angesichts der Tatsache, dass das Buch, obwohl dafür mit Hinweisen auf James Joyce und Vladimir Nabokov geworben wird, was schlicht unverschämt ist, ja auch den Eindruck vermittelt, so etwas wie ein Horror- oder/und Phantasie-Roman zu sein. Und ich liebe schließlich guten, das heißt funktionierenden, wirkenden Horror und einfallsreiche Phantasie. Niemand lebt schließlich von der literarischen Moderne des 20. Jahrhunderts allein! Ich las diesmal bis etwas über die 50. Seite und fand u.a. den erstaunlichen Tatbestand, dass Danielewski an einer Textstelle, die den Begriff des Unheimlichen in den Roman einführt, nun nicht irgendwelche Monster oder sonstwie gearteten unheimlichen Dinge innerhalb der Geschichte geschehen lässt, sondern stattdessen in einer typographisch hervorgehobenen Kolumne Martin Heideggers‘ Definition des Unheimlichen als Zitat einfügt, die Heidegger in seinem Hauptwerk „Sein und Zeit“ aus dem Begriff der „Angst als Grundbefindlichkeit“ entwickelt. Und natürlich hängt daran dann auch gleich die entsprechende Fußnote, die nicht nur die Textstelle bei Heidegger nachweist, sondern auch zugleich durch einen zusätzlichen Kommentar des fiktiven Herausgebers Johnny Truant, des Acid-Heads, all das wieder ad absurdum zu führen versucht, ohne sich der Einsicht verschließen zu können, dass an Heideggers existenzialen Modus des „Un-zuhause-Seins“ etwas Wahres dran sein möge.
Nun, ich weiß immer noch nicht, ob ich dieses Buch bis zum Ende tatsächlich lesen werde. Aber ich habe mich heute entschieden, meinen Leseweg hier im Blog zu dokumentieren, sodass ich am Ende zumindest ein Protokoll haben. Ob auch was für die Erkenntnis dabei heraus kommt? Na, warten wir es mal ab.