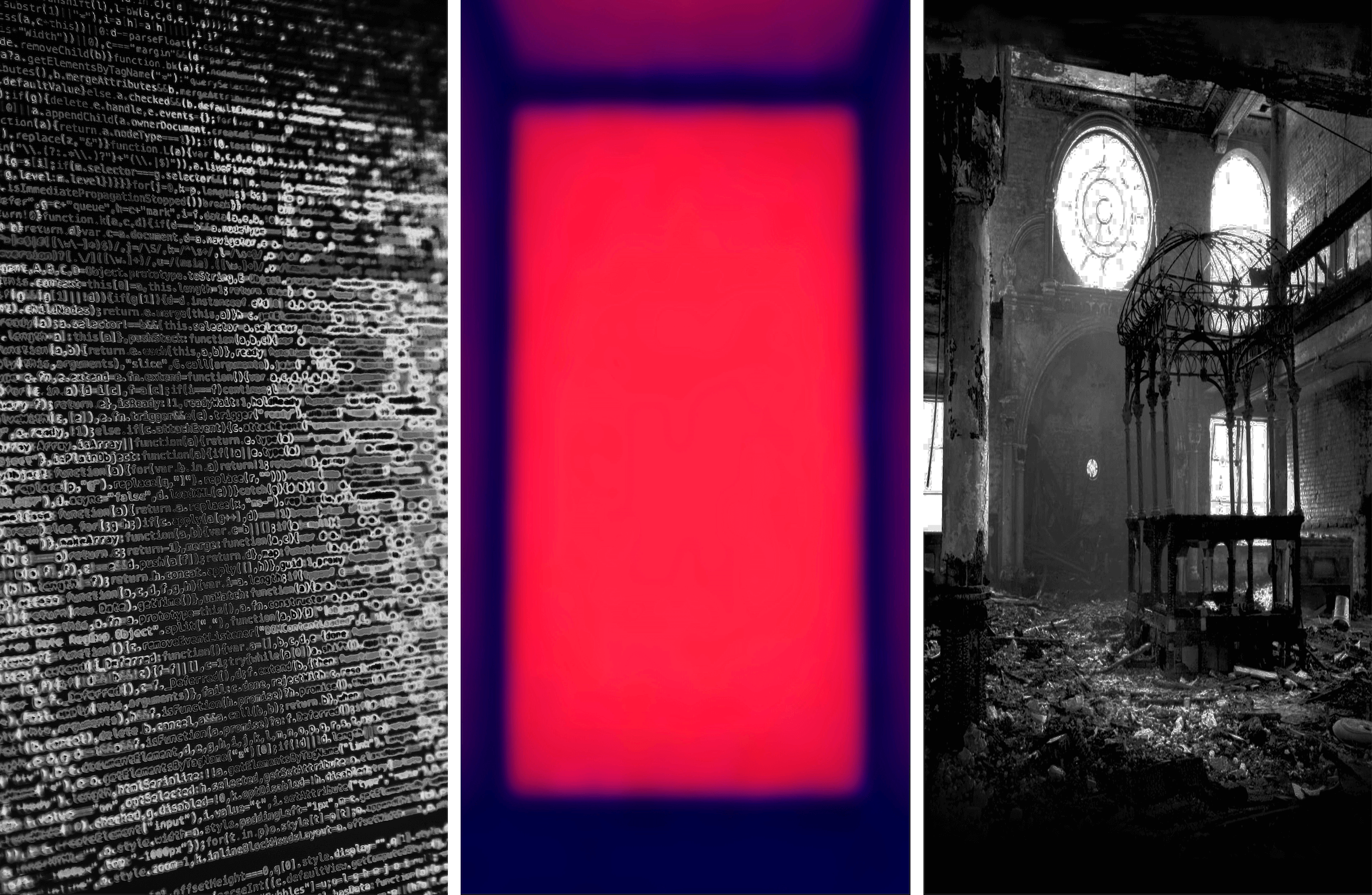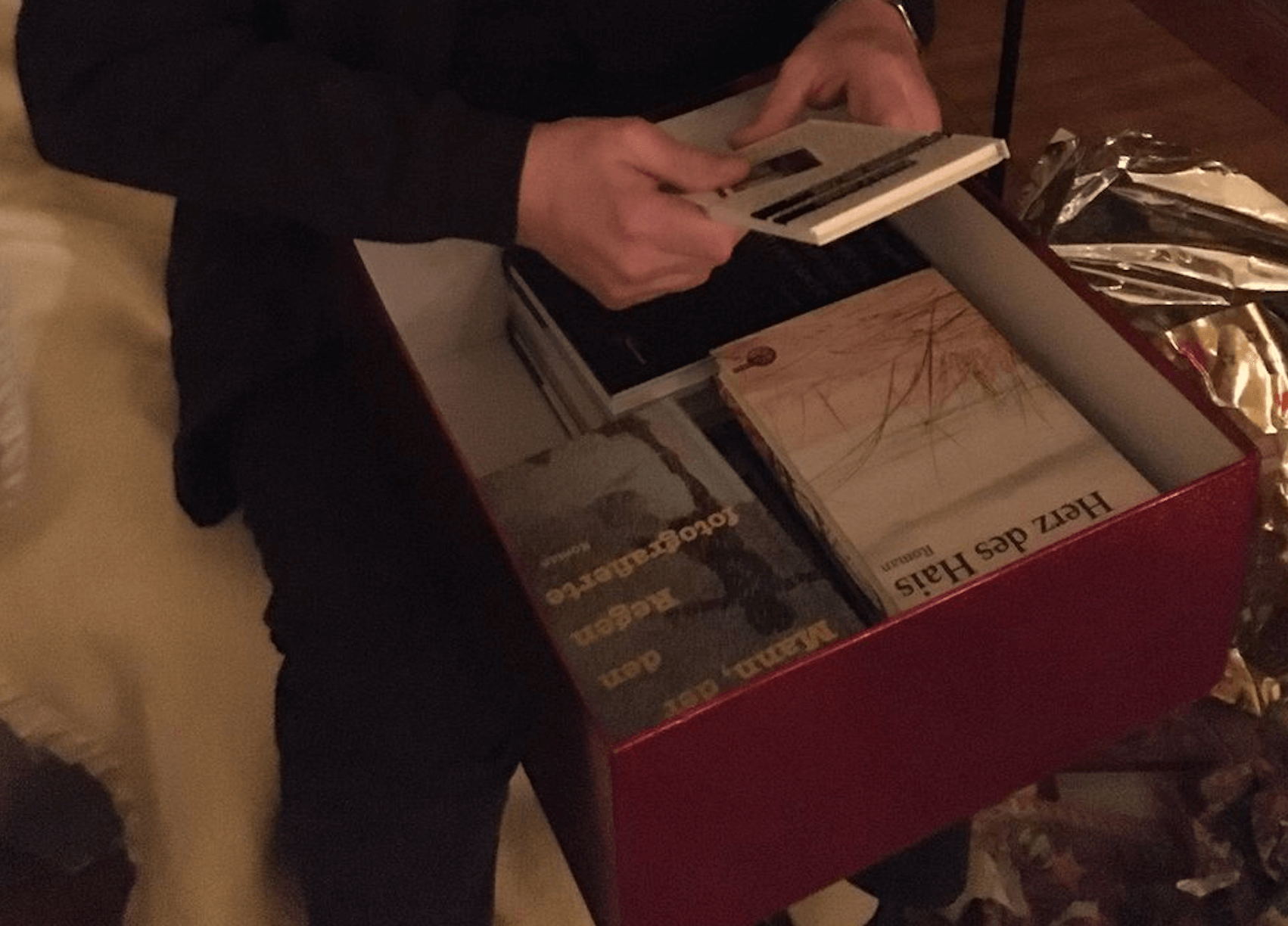Das Herz hat ein langes Gedächtnis
Wir sprechen gern vom „Loslassen“, wenn wir eine Therapie machen oder uns mit Meditation beschäftigen. Wie wichtig es ist, die Fixierungen an eingefahrene Verhaltensweisen und längst unsinnig gewordene Vorstellungen und Reaktionsmuster zu lösen, um uns zu entwickeln und möglicherweise heil und ganz zu werden, ist fast zu einem Gemeinplatz geworden. Schließlich ist das Wissen darum ja auch uralt, hat doch Buddha bereits vor zweieinhalbtausend Jahren das „Anhaften“, also das Nichtloslassenkönnen, als die Quelle allen Leidens identifiziert.
Freilich ist die Vorstellung, die wir mit dem Loslassen verbinden, fast immer die eines geistigen Vorgangs, eines mehr oder weniger bewussten Aktes. Und da wir uns in geistiger Hinsicht für autonom halten, so gehen wir auch davon aus, dass das Loslassen möglich sein muss. Es mag schwierig sein, denken wir, vielleicht bin ich noch nicht so weit, aber andere haben es doch auch geschafft. Warum also nicht ich?
Dass es mit dem Loslassen etwas anders beschaffen sein könnte, hätte ich erstmals vor bald dreißig Jahren verstehen können. Anfang der Siebziger ließ ich mich in die gerade in aller Munde befindliche TM, die so genannte ‚Transzendentale Meditation’ einführen. Dann saß ich, um zu meditieren, doch statt großer Einsichten oder irgendwelcher mystischer Erlebnisse suchte mich überraschend ein heftiger Schmerz im linken Knie heim. Ehe ich mich versah, war ich wieder der zehnjährige Junge von einst, der im Hof hinter der elterlichen Wohnung auf der Kellertreppe hockte, sein blutendes Bein festhielt und sich nicht zu helfen wusste. Dass dieser Schrecken noch in meinem Körper steckte, das hatte ich nicht gewusst. Damals schon hätte ich begreifen können, was da vorlag.
Und auch Jahre später, als ich damit begann, mir im späten Erwachsenenalter das Klavierspielen beizubringen, wäre eine gute Chance gewesen, endlich einzusehen, wie sehr wir Körper sind. Immer unsicher in der schwarzen Zauberschrift der Noten, die vor mir aufgeschlagen standen, begann ich mich darüber zu wundern und zu freuen, wenn meine Finger plötzlich wie von allein eine Passage spielten, ohne dass ich hätte angeben können, wo diese Stelle genau zu finden war. Fingergedächtnis nannte ich das. Wer spielte da eigentlich? Ja, im Grunde griff die Frage sogar noch zu kurz, da schien es nämlich nicht nur ein Gedächtnis in den Fingern zu geben, auch ein Gefühlsleben war vorhanden. Das machte sich zum Beispiel deutlich bemerkbar, wenn ich auf Reisen war und auf das Klavierspiel vorübergehend verzichten musste. In einem Gedicht schrieb ich darüber und nannte es „die verrückte Sehnsucht der Finger / in Abwesenheit des Klaviers“. Noch später, als mein Körper schon längst auf anderen Wegen deutlich auf sich aufmerksam gemacht hatte, schrieb ich ein Gedicht über das Gedächtnis des Herzens, wie ich das nun für mich nannte. Es geht so:
In der Nacht Walzerklänge
Mein Herz, dieser fremde Gast in der Brust.
Regelmäßig am Nachmittag klopft er an,
etwa zwischen vier und fünf.
Ich nehme ihn dann mit auf den Postgang,
rede mit ihm wie mit einem unartigen Kind.
Aber er hört nicht auf mich.
Mag sein, ich habe mit ihm einen alten Vertrag,
an den ich mich nicht erinnere,
und er erfüllt nur seine mahnende Pflicht.
Mag sein, er weiß etwas, das ich nicht wissen will.
Es ist vermutlich das Licht, der Geruch von feuchtem Haar und
Walzerklänge in der Nacht. Die ganze lange Geschichte eben.
Dazu Farben. Resedagrün zum Beispiel, das Blau
im Innern des Eises und das unglaubliche Leuchten
im Moment der Berührung einer fremden Haut.
Mag sein, zwischen uns besteht ein Vertrag
über die Dinge, denen ich untreu geworden bin.
Das Herz kennt all das und bewahrt es auf,
für den Tag, da es bricht. *
Gut möglich, dass die in diesem Gedicht ausgesprochene Vermutung, es bliebe bis zum Tod erhalten, was sich da in der Zeit unseres Lebens in den Körper eingeschrieben hat, pessimistisch klingt. Sicher scheint mir hingegen, dass der Körper all das kennt und es aufbewahrt. Und dass wir darüber in keiner Weise direkte Verfügungsgewalt besitzen und von der Möglichkeit, die Erfahrungen unseres Körpers „loszulassen“, meilenweit entfernt sind, das erscheint mir evident.
In seinem philosophischen Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“ schreibt Jean-Paul Sartre, dass der Körper keineswegs eine zufällige Zutat zu meiner Seele ist „sondern im Gegenteil eine permanente Struktur meines Seins und die permanente Möglichkeitsbedingung meines Bewusstseins als Bewusstsein von der Welt und als Entwurf, der auf meine Zukunft hin transzendiert.“ Wenn dem so ist, dann ist es freilich dringend notwendig, die Erfahrung des Körpers nicht zu ignorieren. Ich habe nicht einmal die Möglichkeit, sie als vergangen abzutun, denn das, was sich in meinen Körper eingeschrieben hat, bestimmt meine Gegenwart ebenso wie die Weise, in der ich mich in die Zukunft hinein entwerfe.
Auch das hatte ich auf der körperlichen Ebene längst erfahren, bevor es mir hinreichend bewusst wurde. Sechs Monate nach einer schweren Krebserkrankung mit erfolgreicher Operation, als alle Welt mir ständig zu meinem neuen Leben gratulierte, fiel mir auf, dass ich immer noch in einer Art Betäubung durch die Welt lief und mir wie ein Zombie vorkam. Ein neues Leben? Was sollte das sein? Und dass ich es bemerkt hatte, reichte noch nicht einmal aus, denn ich brauchte weitere drei Monate, um von dieser Betäubung halbwegs frei zu werden.
Natürlich stimmt es, dass das Anhaften die Ursache allen Leidens ist. Aber um frei zu werden, müssten wir eben auch unsere körperlichen Traumata loslassen können. Kann das gelingen?
Meine alte Freundin G., mit der ich vor über dreißig Jahren studierte, nun längst wie ich im sechsten Lebensjahrzehnt angekommen, lebt ein Leben, das bis auf den heutigen Tag von der Erfahrung des sexuellen Missbrauchs bestimmt ist, den sie in der Kindheit erleben musste. Sie arbeitet selbst als Therapeutin, begegnet dieser traumatischen Erfahrung also gewiss in vieler Hinsicht besser gerüstet, als andere Menschen. Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass der Missbrauch ihr Leben zerstört hat und weiter zerstört. Dies auch nur in Gesprächen und Briefen miterleben zu müssen, hat mich mitunter so bedrückt, dass ich mich immer wieder zu Ratschlägen hinreißen ließ, weil ich nicht ertragen konnte, sie so leiden zu sehen. Warum, so dachte ich, kann sie sich nicht davon befreien? Sie ist doch eine erwachsene, selbstbestimmte Frau. Sie ist doch nicht mehr das Kind von damals! Das ging so lange, bis sie mir endlich zurief: „Bitte keine Ratschläge mehr! Ich kenne sie alle, habe alle ausprobiert. Und ich weiß, dass sie nicht funktionieren.“
Ja, sie hat Recht. Sie hat deshalb Recht, weil wir auf der Ebene des Körpers niemals aufhören werden, eben auch dieses Kind zu sein, als das G. vor Jahrzehnten den Missbrauch ertragen musste. Da können wir im Kopf noch so viel „loslassen“ wollen. Die Sprache des Körpers ist eine andere. Ich gebe G. Recht und trauere gleichzeitig um sie. Allerdings nicht ihrer Vergangenheit wegen. Dieser Teil ihres Lebens ist nicht zu ändern.
Zu ändern wäre nur ihre Gegenwart, und ich bin trotz allem vollkommen davon überzeugt, dass das möglich ist. Wenn das Anhaften die Quelle des Leidens ist, dann ist auch die Befreiung möglich, selbst wenn unser Körper in jeder einzelnen Zelle all das gespeichert haben sollte, was uns jemals widerfahren ist. Dafür müssten wir uns freilich zu allererst von der smarten Vorstellung des Loslassens selbst befreien. Wenn der Körper sich ebenso an jeden Schmerz erinnert, wie er sich Klaviersonaten von Mozart einverleibt, wenn unser Leib also im Grunde eine lebendige Aufzeichnungsfläche ist, auf der jede Freude und jede Narbe ihren Platz hat, wer sind dann wir, dass wir glauben, irgendetwas davon „loslassen“ zu können. Natürlich können wir das nicht! Das einzige, was wir können, ist, die Dinge anzuerkennen.
Ja, ich möchte vorschlagen, das Loslassen gegen das Anerkennen, das Akzeptieren einzutauschen. Das soll nicht heißen, dass man die schlechten Verhältnisse gut heißt. Natürlich sollen wir den Vergewaltiger als das benennen, was er ist, und seiner Strafe zuführen. Selbstverständlich sollen wir den Krebs ebenso bekämpfen, wie wir uns gegen gesellschaftliche Missstände wenden sollten. Aber die Narbe, die wir bei all dem empfangen haben, die ist unser Leben. Die Narbe selbst gilt es zu akzeptieren, so schwer es auch fallen mag.
Als ich kürzlich im Schwarzwald mit einem Überlandbus fuhr, fühlte ich mich gestört, weil der Busfahrer im Radio einen Sender mit deutschen Schlagern laufen ließ. Ich versuchte zuerst weg zu hören, da ich deutsche Schlager meist nur schwer ertrage, und ärgerte mich dann, weil es natürlich nicht gelang. Nun hatte ich die Wahl, ich konnte mich die nächste Stunde sinnlos ärgern oder die Musik akzeptieren. Kaum hatte ich das getan, als ich einen der Texte wahrzunehmen begann. Ein müder Sopran sang immer wieder den Refrain „Wenn das Glück mich verlässt, halt ich die Scherben noch fest.“ Genau so funktioniert es, dachte ich! Wir klammern uns an unsere Lebensscherben, wobei wir uns natürlich wieder und wieder verletzen. Und dann kommen all die Versuche des Loslassens, bei denen wir jedes Mal hoffen, dass die Scherben irgendwie verschwinden werden. Aber die Scherben verschwinden nun mal nicht. Auch sie sind ja unser Leben! Selbst wenn der Kopf es längst vergessen haben sollte, der Körper bewahrt sie alle auf. Wenn man das endlich einmal anerkennen würde, wäre viel erreicht. Nicht leugnen und nicht verteidigen, einfach nur zugeben und ohne Bewertung anschauen. Sich selbst ins Gesicht sehen und zugeben, dieser Mensch, mit diesen Verletzungen, diesen Fehlern, diesen Hoffnungen, dieser Scham usw., das bin ich. Und es ist okay, dass es so ist. Irgendwann kommt dann der Tag, an dem wir feststellen, dass wir aufgehört haben, ständig genau die Handlungen, Gefühle und Gedanken zu wiederholen, die uns mit diesen Scherben verbinden. Das Loslassen, das wir bewusst gar nicht schaffen können, geschieht dann von allein. Ja, wenn wir die Wirklichkeit annehmen können, wie sie ist, dann ist es schon geschehen.
* „In der Nacht Walzerklänge“: aus Peter H. Gogolin: „Ich, Nichts, Vorbei“, Gedichte, Poetische Hefte Nr. 13, Hamburg, 1999