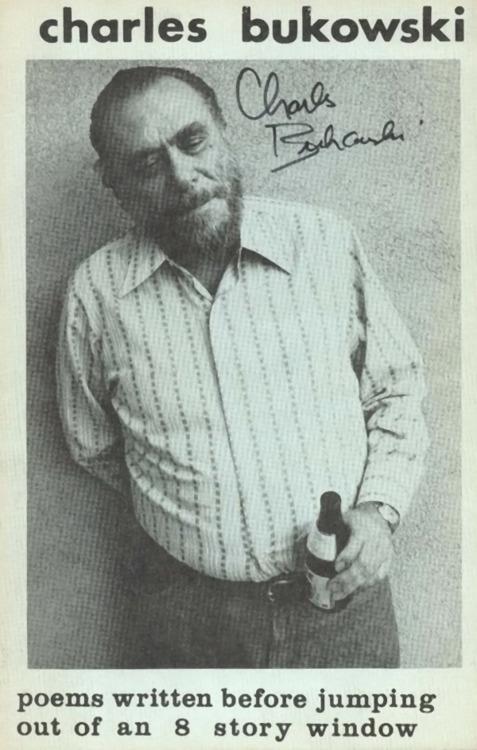Der Idiot der Familie
Ich merkte über Tag, dass …
(habe eben kurz geschwankt, ob ich ‚merkte‘ oder ‚bemerkte‘ schreiben sollte. Entschied mich dann gegen ‚bemerkte‘, da für mein Sprachgefühl im ‚bemerken‘ ein längerer Zeitraum gemeint ist, während das ‚merken‘ kurz, gar augenblicklich erfolgt. Keine Ahnung, ob es nur mir so geht; weder Wahrig noch Duden vermerken (sic!) da einen Unterschied. Aber das gehört wohl in die Kategorie der Wörter, von denen ich schon so oft erleben musste, dass andere da gar keine Differenz wahrnehmen. Wie oft habe ich während des Coachings einem Autor z.B. zu erklären versucht, dass es einen Unterschied zwischen dem Verb ’sehen‘ und dem Verb ’schauen‘ gibt. Nun hatte er/sie zwar sowieso immer nur ’sehen‘ benutzt, aber weil ich das korrigierte und in einigen Fällen stattdessen ’schauen‘ verlangte und er/sie es nicht verstand bzw. völlig gleichgültig fand, so habe ich es begründet. Und da stellte sich dann heraus, dass er/sie es trotz meiner Erklärung nicht nachvollziehen konnte; er/sie vermochte es nämlich nicht zu fühlen. Er/Sie benutzte einfach ein Zeichen, für das es bei ihm/ihr keine körperliche Adäquation gab. Der Unterschied besteht natürlich darin, dass das ’sehen‘ ein passiver Vorgang ist. So man nicht blind und zudem wach ist und die Augen geöffnet hat, so passiert das Sehen einfach. Ich kann dann gar nicht nicht sehen. Das Schauen hingegen ist ein aktiver, gerichteter Vorgang. Und andere Arten der visuellen Wahrnehmung noch viel mehr, das Starren etwa. Aber das muss man körperlich empfinden. Herr/Frau XY, die es nicht empfanden, hätten es nur auswendig lernen können. Aber das hilft natürlich nicht wirklich.)
… das Korrigieren meines Romanmanuskriptes „Das Herz des Hais“ bzw. die Übernahme der schon vor der Reise nach Leipzig handschriftlich gemachten Korrekturen in die Computerfassung weitgehend mechanisch erfolgte. Ich sehe darin ein gutes Zeichen dafür, dass das Buch nun tatsächlich hinter mir liegt. Es geht mir sonst so, auch bei Korrekturen, die nicht entscheidend wichtig sind, dass ich eine recht starke emotionale Beteiligung empfinde, wenn ich Wörter streiche, mich für andere entscheide, Textblöcke umstelle usw. Ja, in der Regel kann ich überhaupt erst auf dieser Gefühlsebene entscheiden, ob ein Text jetzt richtig ist oder nicht. Ich sitze da beispielsweise vor zwei Seiten, die irgendwie nicht funktionieren, d.h. eigentlich funktionieren sie schon, aber nicht so, wie ich es möchte bzw. wie ich glaube, dass sie es tun müssten. Ich könnte aber auch nicht genau sagen, woran das liegt. Und dann probiere ich herum, lese es immer wieder, ändere da vielleicht eine Kleinigkeit und hier noch eine zweite, aber ich weiß dabei, dass das alles Unsinn ist. Man kann das so ändern, aber es ist zugleich Unsinn, weil es darum nicht wirklich geht. Es ist mit diesen zwei Seiten nämlich etwas Grundsätzlicheres nicht in Ordnung. Und dann sehe ich plötzlich (sehen kann man ‚plötzlich‘, schauen nicht), dass da ein ganzer Textblock herausgenommen und an eine andere Stelle versetzt gehört. Und in dem Moment, da ich diese Aktion mit dem Text durchführe, da ist es, als wenn eine Tür ins Schloss fällt, als wenn unvermittelt etwas genau in den Rahmen passt, was vorher immer einige Millimeter zu groß oder zu klein war.
Wie kommt das? Wieso ist das wichtig? Wird man mir nicht sagen, dass ich Unsinn rede? Zumindest aber doch etwas, was niemanden im Ernst interessieren könnte, so man freundlicher mit mir umgehen sollte und nur meine Langweiligkeit anmerken möchte?
Ich glaube hingegen, dass es da um etwas ganz Grundsätzliches geht, das unser Verhältnis zur Sprache betrifft. Oder sagen wir besser, die Art und Weise wie wir Menschen durch Sprache definiert sind; selbst noch der Analphabet ist es ja. Wir sind Sprachwesen. Aber ich denke, dass es in der Sozialisation von uns Sprachwesen einen entscheidenden Punkt gibt, der immer übergangen wird bzw. den man schnell hinter sich lässt oder der, wenn er etwa philosophisch in den Blick genommen wird, (siehe >>>> Jean Baudrillard und das Verschwinden der Dinge, den Wirklichkeitsverlust, der durch die Zeichensysteme erfolgt, die seine Stelle einnehmen in unserer von Zeichen anstelle des Realen erfüllten Welt) nur negativ bestimmt wird. Einzig der Dichter bestimmt ihn positiv, diesen entscheidenden Punkt!
In einer sauberen Welt ist das Ding und sein Zeichen, das also, wodurch das Ding bezeichnet wird, getrennt. Das ist es ja, was wir Menschen seit Adam und Eva machen. Wir verdoppeln die Welt, indem wir sie benennen. Wenn die Bibel Recht hat, dann hat G-tt, dieser alte Spaßmacher und erste Vollzieher des linguistic turn, uns zu diesem Spielchen angeregt und aktiv verleitet. Wer nachschlagen will, die Story ist verzeichnet im 1. Buch Mose unter 1.2, 19f.
Da heißt es: „Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen (Singular! Aber darüber reden wir ein anderes Mal.), dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen.“
Da fängt alles an. Seither haben wir nicht nur die Welt der Dinge sondern auch die Welt der Zeichen. Signifikat und Signifikant. (Ich übergehe hier den Umstand, dass im Schrifttum das Signifikat in der Regel fälschlicherweise mit dem Ding gleichgesetzt wird, das dann der Signifikant bezeichnet. Tatsächlich verweisen nach Saussure aber Signifikat und Signifikant nicht wie Ding und Zeichen aufeinander. Saussure ist nämlich so weit Kantianer, dass er weiß, dass wir von dem Ding an sich nichts wissen können. Das Signifikat bzw. das Signifizierte ist deshalb bei ihm nicht das Ding sondern vielmehr die Vorstellung von dem Ding. Und das Bezeichnende, das Signifizierende, das Zeichen, das auf diese Vorstellung verweist, ist das Lautbild, genauer, die Zeichenfolge, die einen Laut ergibt und eine Vorstellung von einem Ding bezeichnet. So bezeichnet also etwa die Zeichenfolge B a u m das Lautbild Baum, das die Vorstellung des realen Baums signifiziert. Wir haben das Zeichen und das Bezeichnete, wir haben die Welt verdoppelt.
Später werden die Dichter und Schriftsteller hingehen und die Welt der Zeichnen behandeln, als wäre sie selbst real bzw. als stehe sie zumindest stellvertretend für das Reale. Und die Welt wird sich mit all diesen Zeichen anfüllen, ohne dass wir dabei bemerken, dass das Reale, was immer das auch sein mag, dahinter mehr und mehr verschwindet. Aber zu diesem Zeitpunkt sind natürlich längst nicht mehr nur die Dichter und Schriftsteller an diesem Werk des Verschwindens beteiligt. Vielmehr vervielfältigen längst alle Arten von Medien den Kosmos der Zeichen. Und die Dichter sehen mitunter aus, als seien sie selbst deren Opfer.
Aber dem ist nicht so. Dies deshalb, weil die Dichter etwas besitzen, das wie ein Geburtsschaden in ihnen wirkt und verhindert, dass sie dem allgemeinen Bestimmungs-Verhältnis zwischen Signifikat und Signifikant entgehen können. Sie sind diesem rigorosen System der Aufteilung der Welt nicht vollständig unterworfen, weil es in ihnen einen Raum gibt, in dem das Bezeichnete und das Bezeichnende nicht unterschieden werden.
Das mag seltsam erscheinen. Können wir denn überhaupt anders? Ja, wir können und konnten. Der einzige Autor, der dies nach meiner Kenntnis zu erfassen versucht hat, ist der französische Philosoph Jean-Paul Sartre. In seinem Spätwerk >>>> „Der Idiot der Familie“, der monumentalen Untersuchung zum Leben und Werk Gustave Flauberts, das blamablerweise in der Sprachphilosophie bisher keine wesentliche Resonanz fand, (die Philosophie ist seit Beginn der 70ger Jahre andere Wege gegangen, außerdem hat Sartre sich diskreditiert, weil er nicht früh genug zum Stalinismus auf Abstand ging und sich dann auch noch als alter Mann von Andreas Baader instrumentalisieren ließ – aber am Wert seiner Arbeit über Flaubert ändert das alles nichts!) bestimmt Sartre eben diese Bedingtheiten zwischen Autor und Sprache als Ausgangspunkt seiner Studie zu Flauberts Werk, das fundierter nie untersucht worden ist.
Sartre schreibt* „Man wird sich jedoch nicht wundern, daß unter bestimmten Bedingungen die Entwicklung der Sprache stehenbleibt und daß die verbalen Operationen, solange die Entwicklung nicht abgeschlossen ist, verworren erscheinen: ein solches Denken, das durch die reale Anwesenheit seines Zeichens gefangen und verbürgt ist, aber zugleich erdrückt wird, haben wir in den Rezepten der Magie, in den goldenen Versen** und den carmina sacra; wir finden es jede Nacht in unseren Träumen wieder.“
Sartre macht also das dichterische Sprechen in gewisser Weise auf der Ebene des magischen Sprechens fest. Er tut es nicht deshalb, weil er etwas mit Magie am Hute hätte, sondern deshalb, weil er erkennt, dass wir zu dieser Verwechslung von Signifikat und Signifikant neigen, zur Gleichsetzung von Bezeichnetem und Bezeichnendem, das auch magischen Denksystemen eigen ist.
Sartre schreibt über den jungen Flaubert: „Als wenn die Sprache für das Kind nur erst sprechende Geräusche wäre – so wie man von singenden Steinen und weinenden Fontänen spricht. Ist ein solches Verhalten denkbar? Ja: wenn das Verstehen abbricht, bevor es abgeschlossen ist; die Idee bleibt im Ausdruck gefangen, ebenso wie der Ausdruck in den Tönen gefangen bleibt.“
Sartre ist hier dem Wesen des dichterischen Sprechens sehr nahe. Er konnte dem, denn so war sein Thema gewählt, nur am Beispiel von Person und Werk Gustave Flauberts nachgehen. Wäre er dem Thema weiter gefolgt, so hätte er den Rahmen seiner eigenen Ästhetik sprengen müssen. Eben dies müssen wir immer noch tun! Aber Jean-Paul Sartres Werk „Der Idiot der Familie“ – über Gustave Flaubert, den Beginn der literarischen Moderne, den Wandel des Bewusstseins in Zeiten der völligen Unübersichtlichkeit, das nach mehr als drei Jahrzehnten immer noch auf seine Entdeckung wartet – das müssen wir wieder oder erstmals entdecken. Meine Ästhetik kommt von dort her.
Im Vorwort schreibt Sartre: „Ich füge hinzu, daß Flaubert, der Schöpfer des modernen Romans, am Kreuzungspunkt all unserer heutigen literarischen Probleme steht.“ Wie wahr. Und wie entsetzlich, denn tatsächlich ist die heutige Situation ja davon geprägt, dass niemand weiß, dass wir überhaupt ein literarisches Problem haben. Und wenn es denn jemand wüsste, so wäre die Weltlage zugleich voll von so viel größeren Problemen, dass die der Literatur kaum erwähnenswert scheinen. Wer wird uns das verzeihen?!
——–
* Jean-Paul Sartre: Gesammelte Werke, Schriften zur Literatur, Der Idiot der Familie I, Rowohlt Verlag, Reinbeck, 1986, S. 23
** „…goldenen Versen“ – Sartre bezieht sich hier auf das Buch >>>> „Der goldene Zweig“ (The Golden Bough) des Ethnologen und Philologen James Frazer, der die religionsgeschichtlichen und volkskundlichen Hintergründe antiker Texte erforschte.